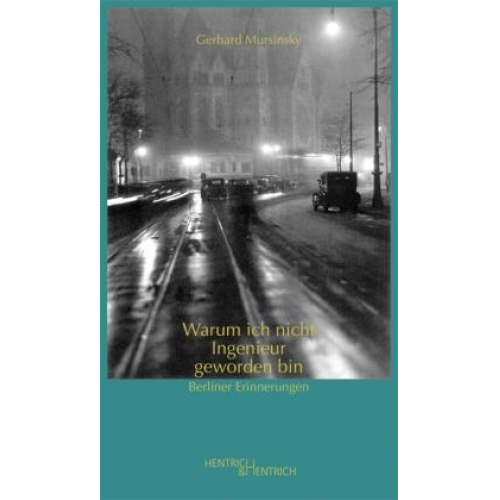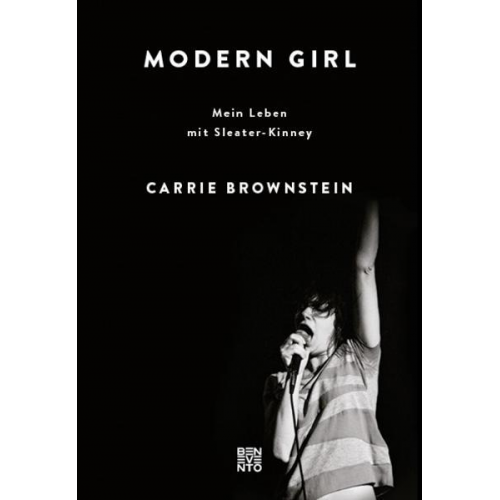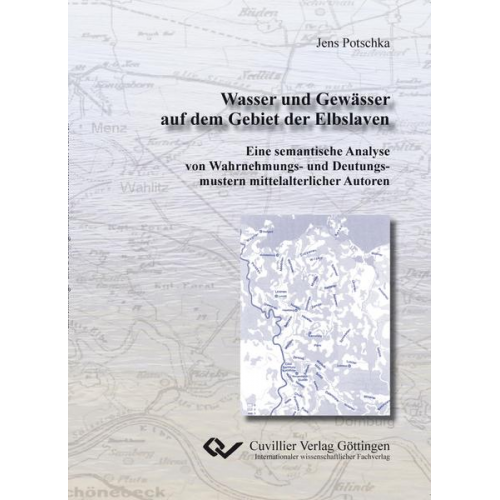
Jens Potschka - Wasser und Gewässer auf dem Gebiet der Elbslaven
49,99 €
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, anhand einer quantitativen historisch-semantischen Analyse die Wahrnehmungs- und Deutungsmuster mittelalterlicher Autoren hinsichtlich ihrer natürlichen Umwelt herauszuarbeiten. Im Fokus standen dabei Veränderungen der Gewässer im Zuge der kulturlandschaftlichen Transformationen des hochmittelalterlichen Landesausbaus des 11. bis 13 Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Die vorhandenen Schriftquellen Ostmitteleuropas ermöglichten in...
Direkt bei Thalia AT bestellenProduktbeschreibung
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, anhand einer quantitativen historisch-semantischen Analyse die Wahrnehmungs- und Deutungsmuster mittelalterlicher Autoren hinsichtlich ihrer natürlichen Umwelt herauszuarbeiten. Im Fokus standen dabei Veränderungen der Gewässer im Zuge der kulturlandschaftlichen Transformationen des hochmittelalterlichen Landesausbaus des 11. bis 13 Jahrhunderts in Ostmitteleuropa. Die vorhandenen Schriftquellen Ostmitteleuropas ermöglichten in eindrucksvoller Weise, anhand einer quantitativen Vorgehensweise ganz unterschiedliche Aspekte der individuellen und kollektiven Wahrnehmung zu differenzieren. Dagegen konnten die Deutungs- und Bewältigungsstrategien der Autoren nur durch qualitative Analyseschritte ergründet werden. Sie waren aus einem sehr breiten Begriffsspektrum zusammengesetzt, traten vergleichsweise selten auf und waren damit allein statistisch nicht fassbar. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass die sprachlichen Veränderungen der schriftsemantischen Felder tatsächlich parallel mit den politischen, kirchlichen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, rechtlichen und kulturlandschaftlichen Prozessen verliefen. Ein ganzes Faktorenbündel veränderte die Schriftsprache in der Germania Slavica. Das Bevölkerungswachstum war die Grundlage für den wachsenden territorialen Anspruch der geistlichen und weltlichen Landesherren, für die Kultivierung von bislang unbewohnten oder nur dünn besiedelten Landschaften und ihrer herrschaftlich-administrativen Durchdringung, für den Aufbau einer Kirchenorganisation, für den Transfer technischer Innovationen vor allem durch die Missionsklöster und die intensiveren Handelskontakte der urbanen Zentren sowie für kriegerische und friedliche Kontakte zwischen den ethnischen Verbänden. Diese Prozesse der longue dureé zeigten sich in der Schriftsprache anhand neuer Begrifflichkeiten und Kollokationen sowie anhand veränderter thematischer Schwerpunkte. Die positive Bewertung der historisch-semantischen Methode als geeignete Vorgehensweise für künftige historische Arbeiten wurde bereits im Zwischenresümee erörtert (B IV. Methodisches und inhaltliches Resümee). Die quantitative Auswertung im ersten Hauptteil ließ auf inhaltlicher Ebene die folgenden Befunde zu: Das Bevölkerungswachstum führte zur Verknappung natürlicher Ressourcen und zur Wertsteigerung bestimmter Güter (Fischteiche, Wassermühlen). Dies bedingte die vermehrte Niederschrift von Gütertransfers bzw. -bestätigungen sowie die Fixierung räumlicher Grenzen – exakter und kleinräumiger als jemals zuvor. Besonders die Zunahme an Grenzbeschreibungen verdeutlicht den fortschreitenden Prozess des administrativen Ordnens bestehender Verhältnisse und Rechte. Die zunehmende begriffliche Vielfalt und sprachliche Spezifizierung der Autoren zeigte sich beispielsweise im Umgang mit den piscationes: Während zuvor ganze Fischteiche verliehen wurden, kam es seit der Mitte des 12. Jahrhunderts zur Vergabe einer Erlaubnis zum Fischen. Gleichzeitig begannen die Autoren, zwischen vier Fangtechniken zu unterscheiden. Die Auswertung der Kollokationen von Elbe und Oder zeigte, dass der Landesausbau in den östlichen Gebieten mit einer zeitlichen Verzögerung gegenüber den Elbgebieten einsetzte, wo nach dem Jahr 1200 die Eigentumsverhältnisse wie auch die militärische Lage weitgehend stabil blieben und daher – im Gegensatz zu den östlichen Gebieten – kaum noch erwähnt werden mussten. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Autoren vor dem Jahr 1200 eher militärische Kontexte bevorzugten. Beispielsweise thematisierten sie bis dahin als typische Wasserbauten Verteidigungsanlagen und Versorgungsgräben, während in der Folgezeit vermehrt Mühlendämme, Hochwasserschutzdeiche sowie Brücken und Häfen als Verkehrsknotenpunkte in ihr Blickfeld traten. Der Hintergrund dieses Kontextwandels liegt aber auch in den verschiedenen Textarten des Corpus begründet, denn die Schriftmuster historiographischer und diplomatischer Texte erwiesen sich als sehr unterschiedlich. Aufgrund der zumeist unterschiedlichen Thematiken benutzten Annalisten und Chronisten ganz andere Kontexte als Lektoren, was sich in bestimmten Kollokationen ausdrückte. Besonders deutlich wurde der Unterschied beim Umgang der Autoren mit Überschwemmungen, Feuchtgebieten und dem Wortfeld „Meer“. Während Historiographen Überschwemmungen eher konstatierten, die Folgeschäden beklagten und ihnen den Charakter einer Katastrophe gaben, begriffen die Diktatoren sie als kurzfristige Erscheinungen und ihre Auswirkungen als lösbare Probleme. Das Meer wie die Feuchtgebiete thematisierten Annalisten und Chronisten primär unter militärischem Blickwinkel (Schutzfunktion), während sie den Diktatoren für Grenzbeschreibungen (Kollokationen mit terminus) dienten. Es stellte sich somit heraus, dass für die Autoren die räumliche Lage der Gewässer von zentraler Bedeutung war. Dabei konnte herausgearbeitet werden, dass sich unterschiedliche Grenzarten bestimmten Grenzformen zuordnen lassen. Vereinfacht verstanden die Autoren Fließgewässer, die sie als Grenzen zwischen ethnischen Verbänden hervorhoben, als Teil eines breiten Grenzsaumes. Der ambivalente Charakter des Fließgewässers als trennender und gleichzeitig verbindender Landschaftstyp war ihnen dabei bewusst. Dagegen begriffen sie Fließgewässer, die sie als politisch-militärische Grenzen und Besitzgrenzen thematisierten, eher als linienförmige Strecken. Etwa seit der Mitte des 12. Jahrhunderts kann dann von einer Ablösung der Grenzsäume durch die Linienform gesprochen werden. Im zweiten Hauptteil der Arbeit konnten durch die qualitative Untersuchung diverse Wechselwirkungen zwischen Mensch und Wasser dargelegt werden. So eröffnete die Kollokation der vier Begriffe flumen/fluvius, census, sal und lignum verschiedene wirtschaftsgeschichtlich und verkehrsgeographisch wichtige Kontexte des mittelalterlichen Alltags an Fließgewässern. Die Salinen erwiesen sich als höchst bedeutsame Wirtschaftsfaktoren, deren gewonnenes Salz in erster Linie über die Flüsse transportiert wurde, um es an Sammelstellen gegen Holzladungen einzutauschen. Die Aufrodung der Wälder im weiteren Umkreis der Salinen dürfte aufgrund des enormen Holzbedarfes bereits zu dieser Zeit weit fortgeschritten gewesen sein. Es gab also hinsichtlich des Waldanteils immense regionale Unterschiede in der Germania Slavica. Die Salzsiedereien importierten ihr Holz aus weit entfernten Regionen wie Böhmen und dem Thüringer Wald, weil es für sie ökonomisch sinnvoller war. Vor diesem Hintergrund erscheint die Herrschaft über Flüsse, genau wie die Herrschaft über Wälder, als Schlüssel zu wirtschaftlicher Macht. Die Landesherrn konnten einerseits über die Anlage neuer Zollstellen oder die Erhöhung der Zölle, und andererseits über die Vergabe von Zollbefreiungen redigierend in das System eingreifen. Anhand der Beispiele der Unstrut bei Vehra, der Ostravice und des Elbenauer Werders konnte exemplarisch gezeigt werden, welche Art von Transformationsprozessen die Autoren wahrnahmen und thematisierten. Neben Extremereignissen (Überschwemmungen) handelte es sich vor allem um Flussbettverlagerungen. Der Verlauf dieser Flüsse hatte als Grenze fungiert, so dass nach deren Transformation eine neuerliche Dokumentation und Präzisierung des Grenzverlaufes notwendig wurde. Der Umgang der Zeitgenossen mit Umwelttransformationen wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung anhand der Fragestellung untersucht, ob sie auch künftig Transformationen erwarteten und inwieweit sie Bewältigungsstrategien entwickelten. Der Befund ergab, dass neben regionalen Unterschieden besonders die Art der Veränderung für die Reaktion ausschlaggebend war: Während sie Inseln in Fließgewässern als vergängliche und instabile Orte wahrnahmen, die man besser nicht besiedeln sollte, kalkulierten sie dagegen ein mögliches Verschwinden von Sümpfen, Wäldern und Bächen in naher Zukunft nur sehr selten ein, sondern benutzten diese weiterhin zur Grenzziehung. Die Flussbettverlagerungen behandelten die Akteure regional unterschiedlich: Die Teilnehmer des Konfliktes an der Unstrut erwarteten zwar weiterhin Überschwemmungen, aber, im Gegensatz zum Herzog von Teschen und dem Bischof von Olmütz, keine erneuten Veränderungen des Flusslaufes. Dies überrascht besonders vor dem Hintergrund, dass der Fluss in diesem Abschnitt als Besitzgrenze diente und noch die Überreste eines alten Flussbettes sichtbar waren. Grundsätzlich erwarteten die Menschen auch zukünftig Umwelttransformationen und versuchten, ihnen aktiv vorzubeugen. Bemerkenswert war die Weitsicht des Herzogs von Teschen und des Bischofs von Olmütz, die von vornherein gleich mehrere künftige Streitvarianten urkundlich regelten: Sie einigten sich auf den Status Quo und legten den Hauptstrom als maßgeblich fest. Diese Regelung umging mögliche Unstimmigkeiten, wenn sich die Ostravice in mehrere Arme aufspalten sollte. Sie vereinbarten auch die künftige ökonomische Nutzung des Flusses, die ebenfalls unabhängig von zukünftigen Flussbettverlagerungen bleiben sollte. Ein derartiger Vorsorgekatalog für den Umgang mit künftigen Umwelttransformationen kann durchaus als Risikomanagement bezeichnet werden und ist ein einzigartiger Befund für das 13. Jahrhundert. Deutlich wurde: Die Zeitgenossen differenzierten auf der Deutungsebene zwischen den für sie ersichtlich anthropogen bedingten und den ihnen natürlich erscheinenden Umwelttransformationen. Waren die Transformationen auf menschliche Auslöser zurückzuführen, konnten sich, wie am Fallbeispiel der Zerstörung des klösterlichen Damms in Vehra dargelegt, rechtliche Folgen ergeben und auf Schadenersatz sowie auf Wiederherstellung des alten Zustandes geklagt werden. Für sie gänzlich natürliche Umwelttransformationen (Akkumulation und Erosion von Flussufern, Zerstörung von Wassermühlen aufgrund von Hochwasser und Eisgang) konnten dagegen niemandem zur Last gelegt werden. Die Autoren betrieben in diesem Fall keine Ursachenforschung. Vermutlich hatten nicht nur die technischen Beschränkungen, sondern auch der Glaube an göttliche Fügung nachhaltige Maßnahmen zur künftigen Risikoverminderung nicht zugelassen. Stattdessen bestimmte der praktische Umgang mit den Folgen das Handeln der Menschen. Verschiedene Strategien halfen, sich unabhängiger von der Willkür der Natur machen: Während die Menschen in Vehra Grenzsteine an das Ufer setzten, ließen die Grundherren an der Ostravice Erdhügel aufschütten, um den Landbesitz abzugrenzen. Dadurch präzisierten sie die Grenze und strebten einen möglichst linearen Grenzverlauf an. Folglich nahmen die Akteure das eigene Verhältnis zur Natur derart wahr, dass ihnen ein gewisser Handlungsspielraum für eigene Aktionen zur Verfügung stand, während die von menschlicher Technik nicht zu leistenden Veränderungen allein Gottes Allmacht und Willen zuzuschreiben waren. Das theozentrische Deutungsmuster für Naturphänomene war einschlägig für die Autoren. Obwohl sie die Natur, speziell Fließgewässer und Unwetter, als handelnde Akteure instrumentalisierten, unterstellten sie ihnen keinen eigenen Willen. Gerade die scheinbare Eigendynamik der Gewalten repräsentierte die Unergründlichkeit göttlichen Willens. So entwarf Bruno das Bild einer von Gott nach ethischen Motiven gesteuerten Natur, die den Gerechten helfe. Interpretationsschwierigkeiten hatten die Autoren bei Naturphänomenen, die sich gegen die von ihnen favorisierten und unterstützten Institutionen oder Aktionen richteten oder diese behinderten. Die Frage nach der Wahrnehmung der Autoren hinsichtlich des Herrschaftsverhältnisses zwischen Mensch und Natur hat sich ihnen selbst nie gestellt. Durch das theozentrische Deutungsmuster war ihnen die Ambivalenz (freundliche/feindliche Natur) und das ständige Wechselspiel zwischen Natur und Mensch als von Gott gelenkt bewusst. Die Autoren begriffen ihre Situation als eingeschränkte Herrschaft über die Natur: Gott konnte die menschliche Herrschaft jederzeit, etwa durch Extremereignisse, wieder beenden. Das einzige Anzeichen eines Wandels der Deutungsmuster im 12. und 13. Jahrhundert war der Hinweis des Magdeburger Annalisten, diverse Katastrophen würden nach Ansicht so genannter Spezialisten der Gestirnkunde mit der Elevation der Planeten zusammenhängen. Dabei nahmen bereits zu dieser Zeit geistige Strömungen ihren Anfang, die den Zugang zur Natur für immer verändern sollten: Die symbolisch-spekulative Interpretation wurde langsam von der Entsakralisierung der Natur und der Wahrnehmung der Natur um ihrer selbst Willen abgelöst. Deren Anzeichen zeigten sich nicht nur in philosophisch-theologischen Traktaten, sondern auch in historiographischen Werken, deren Autoren sich vermehrt mit dem Phänomen „Natur“ selbst auseinandersetzten. Dazu benutzten sie weniger die klassischen Texte wie Isidor oder Beda, sondern verließen sich zunehmend auf die eigene Sinneswahrnehmung, und hier in erster Linie ihre Beobachtungsgabe. Aus dem Resümee der vorliegenden Untersuchung werden Potentiale und Grenzen der quantitativ-semantischen sowie der qualitativen Analyse mittelalterlicher Schriftquellen sichtbar. Die statistische Betrachtung von Häufigkeiten bildet einen fruchtbaren Ausgangspunkt, um sich den Wahrnehmungs- und Deutungsmustern mittelalterlicher Autoren anzunähern und Wandlungen in ihrem kollektiven Erfahrungshorizont nachzuweisen.
| Marke | Cuvillier, E |
| EAN | 9783869557076 |
| ISBN | 978-3-86955-707-6 |
Kategorien
- « Autoreifen
- Beautywelt
-
« Bücher
-
« Schule & Lernen
- « Schulbücher
- « Lernhilfen
- « Lektüren & Interpretationen
- « Sprachen lernen
- « Berufs- & Fachschulen
- « Lexika & Wörterbücher
- « Lehrermaterialien
- Hausaufgabenhefte
- « Formelsammlungen
- Schultüten basteln
-
« Fremdsprachige Bücher
-
« Englische Bücher
- « Schule & Lernen
- « Reise & Abenteuer
- « Sach- & Fachbücher
- « Ratgeber & Freizeit
- « Kinder- & Jugendbücher
- « Klassiker
- « Romane & Erzählungen
- « Krimis & Thriller
- « Comics & Mangas
- « Preisgekrönte Bücher
- « Fantasy
-
« Nach Autoren
- Moyes, Jojo
- Alice Oseman
- Hoover, Colleen
- Sally Rooney
- Tolkien, John R. R.
- Emily Henry
- Karen M. McManus
- Grisham, John
- Matt Haig
- George, Elizabeth
- Ana Huang
- Beckett, Simon
- Mo Xiang Tong Xiu
- Ali Hazelwood
- Taylor Jenkins Reid
- Roberts, Nora
- Aaronovitch, Ben
- James, E. L.
- Cassandra Clare
- Collins, Suzanne
- Sparks, Nicholas
- Brown, Dan
- Flynn, Gillian
- Rowling, Joanne K.
- Baldacci, David
- Carr, Robyn
- Follett, Ken
- Roth, Veronica
- Child, Lee
- McDermid, Val
- Slaughter, Karin
- Gerritsen, Tess
- Martin, George R. R.
- Nesbo, Jo
- Phillips, Susan Elisabeth
- Feehan, Christine
- Preston, Douglas
- Todd, Anna
- Gardner, Lisa
- Gordon, Noah
- Clancy, Tom
- French, Nicci
- Wiggs, Susan
- Glines, Abbi
- Mallery, Susan
- McFadyen, Cody
- Phillips, Carly
- Adler-Olsen, Jussi
- Archer, Jeffrey
- Jackson, Lisa
- Rendell, Ruth
- Forsyth, Frederick
- « Science Fiction
- « BookTok
- New Adult
- Weitere Themenbereiche
- Besondere Ausgaben
- Barack Obamas Reading List
- « Italienische Bücher
- Russische Bücher
- « Niederländische Bücher
- « Französische Bücher
- « Spanische Bücher
- « Sonstige Sprachen
- Portugiesische Bücher
- Türkische Bücher
- « Polnische Bücher
- « Zweisprachige Lektüren
- « Ukrainische Bücher
-
« Englische Bücher
-
« Kinderbücher
- « Zweisprachige Lektüren
- « Nach Alter
-
« Nach Themen
- Liebe & Freundschaft
- Rund um die Familie
- Weihnachten
- Im Kindergarten
- « Geister & Vampire
- Zirkus & Magie
- Feuerwehr & Polizei
- Farben & Formen
- Film & Kino
- Mut & Selbstbewusstsein
- Im Zoo
- « Religion & Philosophie
- Ostern
- Kunst & Musik
- Zeit
- Ferien
- Ritter & Piraten
- Fussball
- Auf der Baustelle
- Fremde Kulturen
- Steinzeit
- Drittes Reich
- Wilder Westen
- Computer & Software
- Wikinger
- « Bilderbücher
- « Romane & Erzählungen
- « Kalender & Alben
- « Spiel & Spaß
- « Sachbücher
-
« Beliebte Kinderbuchreihen
- Der Muffin-Club
- LEGO® Bücher
- Prinzessin Lillifee
- « Conni
- Das magische Baumhaus
- « Augsburger Puppenkiste
- Tilda Apfelkern
- Lotta
- Fünf Freunde
- Mama Muh
- Frau Honig
- Globi
- Pippi Langstrumpf
- Die drei ???
- Hexe Lilli
- Freche Mädchen
- Alea Aquarius
- Leonie Looping
- Die Maus
- Eulenzauber
- Lieselotte
- Rico & Oskar
- Max
- Das Sams
- « Lieder & Gebete
- « Nach Autoren
- « Erstlesebücher
- « Märchen & Sagen
-
« Romane & Erzählungen
- Lyrik
- « Nach Ländern & Kontinenten
- Romane & Erzählungen
- Dramatik
- Kurzgeschichten & Anthologien
- LGBTQ+
- « Liebesromane
- « Historische Romane
- Märchen & Legenden
-
« Nach Autoren
- Brown, Sandra
- Suter, Martin
- Kürthy, Ildikó von
- Heldt, Dora
- Capus, Alex
- Kinsella, Sophie
- Gier, Kerstin
- Peter Prange
- Zafón, Carlos Ruiz
- Berg, Ellen
- Umberto Eco
- Simsion, Graeme
- Cornwell, Bernard
- Safier, David
- Roberts, Nora
- Jonasson, Jonas
- Ahern, Cecelia
- Austen, Jane
- Allende, Isabel
- Jeffrey Archer
- Lorentz, Iny
- Rebecca Gablé
- Laurain, Antoine
- Picoult, Jodi
- Gabaldon, Diana
- McEwan, Ian
- Zeh, Juli
- Spielman, Lori Nelson
- Moyes, Jojo
- Colgan, Jenny
- Hess, Annette
- Meyerhoff, Joachim
- Literatur
- Witz & Unterhaltung
- « Nach Emotionen
- Biografische Romane
- Klassiker
- Unterhaltung für Frauen
- « Jugendbücher
-
« Krimis & Thriller
- « Nach Ländern
- « Thriller
- « Regionalkrimis
-
« Nach Autoren
- King, Stephen
- Christie, Agatha
- Brown, Sandra
- Adler-Olsen, Jussi
- Bannalec, Jean-Luc
- Gruber, Andreas
- Cornwell,Patricia
- Krist, Martin
- Reichs, Kathy
- Fitzek, Sebastian
- Franz, Andreas
- Klüpfel & Kobr
- George, Elizabeth
- Wolf, Klaus-Peter
- Neuhaus, Nele
- McDermid, Val
- Gerritsen, Tess
- Nesbø, Jo
- Schätzing, Frank
- Falk, Rita
- Nesser, Hakan
- Cosy Crime
- Mystery
- Horror
- Historische Krimis
- Humorvolle Krimis
- « Nach Emotionen
- Drogen-Kriminalität
- Weibliche Ermittlerinnen
- Preisgekrönte Krimis
- Wahre Kriminalfälle
- Tierkrimis
- Gerichtsmedizin
-
« Reisen
- « Reiseführer
- « Bildbände
- « Reiseberichte
- « Atlanten & Karten
- « Wandern & Radwandern
- « Restaurant- & Hotelguides
- « Reisen mit Kindern
- Camping & Caravaning
- « Manga
- « BookTok
-
« Sachbücher
- « Religion & Glaube
- « Kunst & Kultur
-
« Business & Karriere
- « Wirtschaft
- « Kosten & Controlling
- « Börse & Geld
- « Personal
-
« Management
- Konfliktmanagement
- Projektmanagement
- Verhandeln & Motivieren
- Führung & Personalmanagement
- Strategisches Management
- Prozessmanagement
- Qualitätsmanagement
- Unternehmensplanung & -kultur
- Kulturmanagement
- Wissensmanagement
- Einkauf & Logistik
- Unternehmensbewertung
- Organisationsmanagement
- Finanzierung & Investition
- Zeitmanagement
- Informationsmanagement
- Mergers & Acquisitions
- Internationales Management
- Change Management
- Business & Businessplan
- « Marketing & Verkauf
- « Job & Karriere
- « Kommunikation & Psychologie
- « Bilanzierung & Buchhaltung
- E-Business
- « Branchen & Berufe
- « Bewerbung
-
« Naturwissenschaften & Technik
- « Umwelt & Ökologie
- « Mathematik
-
« Medizin
- Allgemeines & Lexika
- Pharmazie
- Zahnmedizin
- Alternative Heilmethoden
- Nach Körperteile
- Chirurgie
- Veterinärmedizin
- Gynäkologie
- Innere Medizin
- Notfallmedizin
- Pflege
- Pädiatrie
- Psychiatrie
- Allgemeinmedizin
- Neurologie
- Für´s Studium
- Orthopädie
- Dermatologie
- Pathologie
- Sportmedizin
- Anästhesie
- Diagnostik
- Intensivmedizin
- Anatomie
- Psychologie
- Weitere Themen
- Medizin & Gesellschaft
- Rechtsmedizin
- « Erdkunde & Geologie
- « Biologie
- « Physik
-
« Ingenieurwissenschaft & Technik
- Maschinenbau
- Elektro- & Nachrichtentechnik
- Kraftfahrzeugtechnik
- Ingenieurwissenschaft
- Bautechnik & Architektur
- Energietechnik
- Allgemeines & Lexika
- Meßtechnik
- Weitere Themengebiete
- Halbleiter
- Philosophie & Technikkritik
- Normierung
- Informationstechnik
- Robotik
- Mechanik
- Verfahrenstechnik
- Prüf- & Reglungstechnik
- « Chemie
- « Weitere Themenbereiche
-
« Politik & Geschichte
-
« Geschichte nach Themen
- Religionsgeschichte
- Architekturgeschichte
- Einführungen & Nachschlagewerke
- Wirtschaftsgeschichte
- Geschichte der Wissenschaften
- Militärgeschichte
- Stadtgeschichte
- Frauen in der Geschichte
- Musik- & Kulturgeschichte
- Allgemeine Weltgeschichte
- Alltagsgeschichte
- Rechtsgeschichte
- Weitere Themengebiete
- Sportgeschichte
- Sozialgeschichte
- Technikgeschichte
- Medien- & Filmgeschichte
- Allgemeines & Lexika
- « Biografien & Erinnerungen
- « Gesellschaft
- « Nach Ländern & Kontinenten
-
« Deutsche Geschichte
- Wirtschafts- & Sozialgeschichte
- Erster Weltkrieg
- Das Dritte Reich
- Revolution 1918
- Reichsgründung & Deutsches Kaiserreich
- Gesamtdarstellungen
- Nachkriegszeit & Wiederaufbau
- Zweiter Weltkrieg
- Reformation & Gegenreformation
- SBZ & DDR
- Habsburg
- Revolution 1848
- Wiedervereinigung
- Militärgeschichte
- Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation
- Preußen
- Mittelalter
- Studentenbewegung 68
- Weimarer Republik
- RAF
- Frühgeschichte
- Otto von Bismarck
- Dreißigjähriger Krieg
- « Deutsche Politik
- « Nach Epochen
- « Politik nach Bereichen
- Klimawandel
- Nach Personen der Weltgeschichte
- « Terrorismus & Extremismus
- « Kriege & Krisen
- Politikwissenschaft
-
« Geschichte nach Themen
- « Computer & Internet
- « Biografien & Erinnerungen
- « Esoterik
-
« Fachbücher
- « Sprach- & Literaturwissenschaft
- « Geschichtswissenschaft
- « Theologie
- « Philosophie
-
« Psychologie
- Entwicklungspsychologie
- « Psychotherapie
- Allgemeines & Lexika
- Einführungen & einzelne Psychologen
- Weitere Fachbereiche
- Arbeitspsychologie
- Diagnostik & Methoden
- Klinische Psychologie
- Sozialpsychologie
- Gesundheitspsycholgie
- Psychiatrie
- Emotionspsychologie
- Pädagogische Psychologie
- Persönlichkeitspsychologie
- Analytische Psychologie
- Individualpsychologie
- Neuropsychologie
- Geschichte der Psychologie
- Gerontopsychologie
- « Kunstwissenschaft
- « Architektur
- « Politikwissenschaft
-
« Wirtschaft
- Wirtschaftstheorie
- Betriebswirtschaft
- Allgemeines & Lexika
- Wirtschaftspolitik
- Volkswirtschaftslehre
- Wirtschaftsmathematik
- Handels- & Wirtschaftsrecht
- Wirtschaftsgeschichte & -theorie
- Bankwesen & Börse
- Weitere Fachbereiche
- Wirtschaftsinformatik
- Wirtschaftswissenschaft
- Wirtschaftskrise & -kriminalität
- « Recht
-
« Medizin
- « Pflege
- Allgemeines & Lexika
- Weitere Heilberufe
- Psychiatrie
- « Grundlagen
- Neurologie
- Medizin & Gesellschaft
- Weitere Fachbereiche
- Alternative Heilmethoden
- Chirurgie
- Intensivmedizin
- Veterinärmedizin
- Studium Humanmedizin
- Pädiatrie
- Studium Pharmazie
- Gynäkologie
- Zahnmedizin
- Orthopädie
- Diagnostik
- Dermatologie
- Notfallmedizin
- « Informatik
- « Medienwissenschaft
- « Pädagogik
- « Sozialwissenschaft
- « Geowissenschaften
- « Musikwissenschaft
- « Physik & Astronomie
- « Mathematik
- « Chemie
- « Ingenieurwissenschaften
- « Biowissenschaften
-
« Schule & Lernen
-
« Bürobedarf
- Individuelle Stempel
- Infotafeln, Namens-, Tür-, Infoschilder
- Zubehör Ordner
- Prospekthüllen
- Hängeregistraturzubehör
- Sonstige Hüllen
- Hängeregistratur neutral
- Register aus Kunststoff
- Register Papier, Pappe, Mylar
- Kugelschreiber
- Zubehör Planung (außer Marker, Nadeln...)
- Kunststoffordner Marken
- Sonstige Planungsmittel
- Zubehör Visitenkarten
- Buchversandkartons
- Ordnerversandkartons
- Bleistifte (Holz- u. Druckbleistifte)
- Sonderordner (Doppelo., Sonderformate)
- Sichtwender
- Trennblätter u. Trennlaschen
- Hängeregistratur farbig
- Briefkörbe
- Zubehör Kartei (Stützplatten...)
- Fineliner
- Tintenroller u. Gelroller
- Kohle- u. Durchschreibepapier
- Kunststoffordner Eigenmarken
- Hängeregistratur Eigenmarken
- Büromöbelprogramme
- Zubehör Armlehnen
- Lagerregale
- Hocker (auch Rollhocker)
- Zubehör Lagereinrichtung
- Sonstige Büroschränke Stahl
- Vorhängeschlösser
- Zubehör Rollen
- Sichtbücher, Prospektalben u. Ringmappen
- Pappordner neutral
- Prospektständer
- Garderobenständer
- Bodenputzgeräte
- Mehrzwecktische, Konferenztische
- Toilettenpapier, trocken (traditionell)
- Kleiderbügel
- Ledersessel
- Hängeregistraturschränke Stahl
- Schubladenschränke Stahl
- Schlüsselkästen
- Sonstiges EDV-Zubehör (Mouse-Pads...)
- Datenträgeraufbewahrung (Disk.boxen...)
- Spezialbeschichtetes-/Fotopapier Inkjet
- Matrix Original
- Visitenkarten weiß
- Endlospapier weiß
- Endlospapier mit Liniendruck
- Formularbücher A-Z Kohlepapier
- Formularbücher A-Z Selbstdurchschreibend
- Sonstige Blöcke
- Formularbücher A-Z einfach
- Sonstige Etiketten
- Universaletiketten weiß
- Computeretiketten
- Vielzwecketiketten
- Adressetiketten
- OHP-Folien Laser
- Batterien
- Zubehör Diktier- u. Wiedergabegeräte
- Scheren, Cutter u. Briefbesteck
- Sonstige Küchenhelfer u. -werkzeuge
- Schreib-, Konferenzmappen aus sonst. M.
- Zubehör Terminplaner
- Einweg-Gläser, -Becher, -Tassen
- Sonst. Taschen (Kultur-, Hand-, Kühlt.)
- Geschirr
- Bewerbungsmappen
- Spitzer, Spitzmaschinen
- Textmarker
- Pappordner Marken
- Hängeregistratur Marke
- Gutscheine u. Karten
- Klemm-Mappen, Klemmschienen inkl. Hüllen
- Moderationsmarker (Flipchart- u. Boardmarker)
- Ordnungsmappen, Fächermappen
- Universalmarker (inkl. OHP)
- Heftmechaniken, Heftstreifen, Abheftsch.
- Terminplaner
- Pflaster & Verbandsmaterial
- Bürowagen
- Sonstige Einwegartikel
- Zubehör Schlüsselkästen
- Papierschreibunterlagen
- Schiebetürenschränke Stahl
- Dokumentenkassetten
- Heftklammern
- Designpapier
- Markierungspunkte
- Briefumschläge gummiert
- Archivprodukte aus Karton inkl. B.bügel
- Briefumschläge Design u. Farbe
- Hebelschneidemaschinen
- Heftgeräte, Heftzangen, Enthefter
- Spezialmarker (Lackmarker, Dekomarker...)
- Geschäftsbücher
- Visitenkarten-Bücher, -Mappen, -Sammler
- Sonstige Spender für Hygiene
- Spendegeräte im Büro
- Tisch-Flipchart
- Laminierfolien 100 micron
- Sichthüllen
- Akkumulatoren
- Designvisitenkarten u.farbig
- Zubehör Anschießpistolen
- Diktiersysteme analog
- Präsentationsmappen u. -boxen m. Sichtt.
- Datenträger-Etiketten
- Notizbücher
- Sonstige Bürokleingeräte
- Locher (auch Doppel-, Mehrfachlocher...)
- Schirmständer
- Übrige Schreib- und Malartikel
- Universaletiketten wiederablösbar
- Universalpapier A3 weiß
- Kabel für Fernseher
- Haftnotizen Z-Notes
- Doppelseitige klebende Pads und Bänder
- Mülleimer
- Spendegeräte im Versand
- Verbandsschränke
- Papierhandtücher
- Belegfächer, Organizer, Schubkästen
- Inkjetpapier A4 weiß über 80g
- Arbeitsplatzorganisation
- Tafel-Flipchart
- Schubladenboxen
- Zubehör Putz- u. Reinigungsgeräte
- Wanduhren
- Ringbücher, Präsentationsringbücher
- Visitenkarten-Boxen
- Haftmarker Film einfach
- Stative
- Briefwaagen
- Spezialbeschichtetes- /Fotopapier Laser
- Besteck
- Notizzettelblöcke und -Spender
- Lagerboxen
- Faltkartons standard
- Deckfolien u. Rückwände
- Eckspannmappen
- Aktendeckel, Sammelmappen
- Dokumentenboxen (ohne Einschubtasche)
- Speziallaminierfolien
- Visitenkarten-Etuis
- Stempelkissen
- Ordnerdrehsäulen
- Karteikästen, Boxen
- Kunststoffhefter f. gelochtes Schriftgut
- Hängeregistraturboxen (ohne Mappenboy)
- Zirkel
- Sortierstationen
- Lineale, Geodreiecke
- Stehsammler
- Versandtaschen mit Falte
- Spezial-Hängeregistraturen
- Memotafeln magnetisch (Weißwand...)
- Sonstige Registraturartikel (Lochverst.)
- Haftmarker Film Sonderausführungen
- Halter (Handtuch-, Fön-, Toilettenp.h.)
- Hängeordner
- Kartonhefter für gelochtes Schriftgut
- Radierer
- Thermo Original
- Briefumschläge selbstklebend
- Farbpapier A4
- Pappordner Eigenmarken
- Luftballons
- Pultordner, Vorordner
- Universaletiketten farbig
- Standardstempel
- Zubehör Stempel
- Fußstützen
- Zubehör Beschriftungsgeräte
- Zubehör Preisauszeichnung
- Geldkassetten
- Visitenkarten-Spender
- Toner Original
- Briefblöcke A4
- Collegblöcke A4
- Toner Eigenmarke
- Tinte Eigenmarke
- Universalpapier A4 weiß über 80g
- Universalpapier A4 weiß unter 80g
- Universalpapier A4 weiß 80g
- Zubehör (z.B. Einzel- und Ersatzteile)
- Kleiderspinde
- Zählbretter
- Endlospapier farbig
- OHP-Folien Inkjet
- Kopierfolien
- Pappordner vollfarbig (auch gestaltet)
- Schreib-, Konferenzmappen aus Leder
- Datenträger optisch
- Aschenbecher
- Flügeltürenschränke Stahl
- Tabletts
- Papierkörbe
- Wasserzeichenpapiere
- Telefon-Ringbücher
- Schreibunterlagen, Schreibtischsets
- Haftmarker Papier einfach
- Haftnotizen mit extra starker Klebekraft
- Haftnotizwürfel
- Haftnotizen gelb
- Sonstige Haftnotizen
- Zubehör Festnetztelefone
- Zubehör Etikettendrucker
- Sonstige Kleinmöbel
- Rollcontainer
- Tinte Original
- Polsterversandtaschen (alle Materialien)
- Preisauszeichnungsetiketten
- Zubehör Aktenvernichter (Abfalls., Öl)
- Frankieretiketten
- Schul-/Wissenschaftsrechner
- Aktentaschen u. -mappen etc. aus Leder
- Aktentaschen u. -mappen aus sonst. M.
- Wandgarderoben
- Akten- u. Pilotenkoffer aus Leder
- Sonstiges Eventmaterial
- Dokumententaschen u. Etikettenschutzfilm
- Zubehör Thermobindegeräte
- Türstopper, Schutzfilze, Zugluftstop etc.
- Nicht druckende Tischrechner
- Drehstühle
- Hubwagen
- Zubehör Rechner
- Büroregale
- Haftmarker Papier Sonderausführungen
- Karteischränke Stahl
- Tintenlöscher
- Vitrinen
- Müllsäcke
- Laminierfolien 125 micron
- Laminierfolien 75 micron
- Zubehör Drahtkammbindung
- Zubehör Kunststoffbindung
- Schaukästen
- Sonstige Hygieneartikel
- Kartonversandtaschen
- Verbandkästen & Erste-Hilfe Sets
- Tinte Kompatibel
- Sonstige Formularbücher
- Briefumschläge haftklebend
- Zubehör Buchbindegeräte
- Wiedergabegeräte
- Leitern
- Laminierfolien 80 micron
- Tischleuchten
- Rollenschneidemaschinen
- Zubehör Schneidemaschinen
- Moderationswände
- Besucherstühle
- Akten- u. Pilotenkoffer aus sonstigem M.
- Buchbindegeräte
- Sonstige Zuschnitte (CD-/ DVD-Einleger)
- Trennwände
- Vielzweckklemmen
- Fensterputzgeräte
- Aktenvernichter-Streifenschnitt
- Aktenvernichter-Partikelschnitt
- Schiebetürenschränke Holz, Kunststoff
- Tresore
- Collegblöcke A5
- Notiz- u. Spiralblöcke (Kleinformate)
- Toner Kompatibel
- Versandtaschen standard haftklebend
- Versandtaschen reißfest (Tyvek o.ä.)
- Versandtaschen mit Kartonrückwand
- Sonstige Ordnungsbehälter (Köcher...)
- USB-Sticks
- Taschenrechner
- Taschenlampen/-leuchten
- Unterschriftenmappe
- Gartentische
- Transportwagen
- Haftnotizen recycling
- Preisauszeichnungsgeräte
- Laminierfolien 250 micron
- Laminierfolien 175 micron
- Handtuchspender
- Toilettenpapierspender
- Briefblöcke A5
- Staubsaugerbeutel
- sonstige Accessoires (Freizeit)
- Thermo Kompatibel
- Laminiergeräte
- Matrix Kompatibel
- Sonstige Universaletiketten
- Kanzleipapier
- Servietten
- Eintrittsbänder
- Notebooktaschen u. -koffer
- Absperrung/Leitsysteme
- Hinweisschild/Aufkleber
- Laserpapier A4 weiß über 80g
- Laserpapier A3 weiß
- Plantafeln (Jahresplaner, Projektplaner)
- Zubehör Drucker (Ohne Papier u. Ti/To)
- Zubehör Kabel
- Speicherkarten
- Sonstige Dekorationsartikel
- Kerzen
- Sonstige Versandtaschen (Freistempler...)
- Paketwaagen
- Schulhefte, Löschpapier
- Putztücher, Schwämme u. Bürsten
- Zubehör zur Kaffee- u. Teezubereitung
- Millimeterpapier
- Servierwagen
- Sonstige Geschenkverpackungen
- Umschläge, Schoner
- Verpackungsbeutel
- Stationäre Scanner (auch Tunnelscanner)
- Geldprüfgeräte
- Sonstige Kleinteile (Elastikpuffer...)
- Arbeitshandschuhe
- Datenträger magnetisch
- Kommunikations/Netzwerke u. Komponenten
- Versandtaschen standard gummiert
- Versandtaschen standard selbstklebend
- Einweg-Geschirr
- EDV- Eingabegeräte (Tastatur, Mouse...)
- Büroklammern, Aktenklammern
- Musterbeutelklammern
- Nadeln, Reißnägel, Pinnwandstifte
- Lautsprecher (als Multimediakomponenten)
- Tachographen-Aufzeichnung u. -Zubehör
- EDV-Peripherie
- Spezialhefte (Zeichen, Noten, Steno...)
- Etikettendrucker
- Zahnstocher, Rührstäbe
- Anrufbeantworter
- Thermobindegeräte
- Zeichen- / Malblöcke
- Krankenliegen-/transport
- Sonstige Erste-Hilfe
- Buchkalender
- Haftnotizen farbig
- Schablonen
- Universalpapier A4 recycling
- Ringbucheinlagen
- Festplatten
- Winterdienst
- Steckdosenleisten
- Beschriftungsgeräte Bänder
- Kopfhörer portable
- Polstermaterial (Folien, Flocken...)
- Zubehör Beamer/Projektion
- Diktiersysteme digital
- Schreibtische
- Sonstiges Geschirr, Gläser, Besteck
- Zubehör Fotokameras
- Zubehör Schreibmaschinen
- Sammeltaschen (Klett-, Druck- u. Reißv.)
- Kunststoff-Bindegeräte
- Thermo Eigenmarke
- Druckende Tischrechner
- Visitenkarten-Rotationskarteien
- Geschirrtücher
- Stempeluhren u. Zubehör
- Computertische
- Tageslichtprojektoren
- Sonstige Putz- u. Reinigungsgeräte
- Beschriftungsgeräte
- Ladegeräte
- Geschenkkartons,-tüten und -beutel
- Zubehör Kassen
- Geldzählmaschinen
- Sonstige Elektronische Einrichtung u. V.
- Zubehör KFZ-Navigationssysteme
- Zubehör Laminiergeäte (Lochzange...)
- Zubehör Geräte zur Datenverarbeitung
- WC-Garnitur
- Isolierkannen, -becher u. Flaschenkühler
- Drahtkamm-Bindegeräte
- Pinntafeln (Stoff, Kork...)
- Schnurlose Telefone
- Sackkarren
- Werkbänke
- Wandhalterungen für Fernseher
- Brief-, Paketkästen, Zeitungsrollen
- Mikrowellen
- Zubehör Reinigungsgeräte
- Mobiltelefone
- Kosmetiktücher
- Kopfbedeckungen
- Arbeitskittel
- Überschuhe
- Laufwerke (z.B. Floppydisk, Harddisk...)
- Wandkalender
- Schnurgebundene Telefone
- Staubsauger
- Geldbörsen, Schlüsselanhänger
- Geschenkbänder, -schleifen u. -anhänger
- Zubehör Transportgeräte u. Leitern
- Stapelschneidemaschinen
- Transparentpapier
- Sonstige Briefblöcke
- Zubehör Elektrowerkzeuge
- Farbpapier A3
- Handscanner (Lesestifte)
- Aktenvernichter-Stapelvernichtung
- Werkstattschränke
- Bohrmaschinen, Bohrhammer, Bohrschrauber
- Sonstiges Farbpapier
- Schutzbrillen & -visiere
- Gehörschutz
- Pinsel, Farbwalzen, Baueimer
- Spannwerkzeuge (Schraubzwingen, -stock)
- Kopfschutz
- Sicherheitsschuhe/Sicherheitsstiefel
- Schrauben, Nägel, Dübel
- Rucksäcke
- Decken- u. Pendelleuchten
- Meßwerkzeuge
- Schraubwerkzeuge, Schraubendreher
- Seifenspender
- Garten- und Grünflächenpflege
- WC-Sitz
- Stehpulte
- Kombibindung (Drahtkamm u. Kunststoff)
- Handtücher
- Küchentücher/Küchenrollen
- Zubehör Geräte zur Datenspeicherung
- Aluminiumkoffer
- Sonstige Klebemittel (Klebepistole...)
- Hakenleisten, Klemmleisten
- Werkstattwagen
- Universalpapier A5
- Zubehör Mobile Kommunikation
- Rauchmelder
- BluRay-Player
- Elektronische Zeiterfassungssysteme
- Toaster
- Anschießpistolen
- Arbeitsplatz- und Lupenleuchten
- CD-Player
- Stehleuchten
- Toilettenpapier, feucht
- Sonstige Hygienepapiere
- Briefumschläge Revelope
- Wasserkocher
- Flügeltürenschränke Holz, Kunststoff
- Softwarelösungen u. Handbücher
- Leinwände
- Fahrradständer
- Alternatives Sitzen
- Regenschirme
- Feuerlöschmittel
- Bastellkoffer & -sets
- Überwachungsanlagen u. Überwachungskam.
- sonstiges Zubehör Blumen u. Pflanzen
- Universalfernbedienungen
- Headsets
- Warnjacken & -westen
- Ablagen
- Uhrenradio
- Sonstiger Bastelbedarf
- Minibackofen
- Schneidewerkzeuge + Zangen
- Schall, Akustik
- Sonstiges Zubehör
- Sonstige Sitzmöbel u. Zubehör
- Reisetaschen u. -koffer
- KFZ-Navigationssysteme
- Überspannungsschutz u. Ausfallsicherung
- Aufkleber (Buchstaben, Zahlen, Motive,Sticker)
- Sonstige Präsentationsmittel
- Wecker
- Kaffeemaschinen
- Grill
- Werkzeugkoffer/ Sortimentskasten
- Dosenöffner
- Baustellenleuchten (Stableuchten...)
- Funksteckdosen
- CD-Radio
- Sonstige Navigationssysteme
- Schnurgebundene Telefone mit Anrufb.
- EDV-Reinigungsmittel
- Sonstiges Badzubehör
- Gartenbänke
- Beamer
- Wetterstationen
- Flaschenöffner
- Funkgeräte
- Digital Signage Displays
- Powerbanks
- Korkenzieher
- Sonstige Collegblöcke
- Sonstige Reinigungsmittel
- Digitale Notetaker
- Gläser
- Trinkhalme
- Einweg-Besteck
- Sonstige Bodenreinigungsgeräte
- Luftschlangen
- Ventilatoren
- Badmöbelprogramme
- Papiertaschentücher
- Synthetikpapier
- Sonstige Geschäftsbücher
- Multifunktionswerkzeug (elektrisch)
- Sägen (elektrisch)
- Werkzeugakkus, Ladegeräte
- Winkelschleifer, Vibrationsschleifer
- Heißluftgeräte (elektrisch)
- Fahrradschlösser
- Personen-Waage
- Hautpflegemittel (Cremes, Duschgel)
- Papiertragetaschen
- Einmalhandschuhe
- Kompressoren inkl. Zubehör
- Heizkissen/-decken
- Nass-/Trockensauger
- Webcam
- Mundpflegemittel
- Bastelfarben
- Hand-Desinfektionsmittel
- Motorrad-Navigationssysteme
- Zählwaagen
- Heizlüfter
- Universaletiketten recycling
- Großformatdrucker
- Zubehör Elektrowärme- u. Klimageräte
- Leuchten für Leuchtzwecke
- Schreibmaschinen
- LED-Lampe
- Luftreiniger
- Sonstige Kartons (Umzugskartons...)
- Wasser- und Gasmelder
- Plattenspieler
- Außenleuchten
- Handytaschen
- Kanister
- Smart Home
- Fensterreinigungsgeräte
- Sonstiger Schulbedarf
- Sonstige Briefumschläge
- Farbpapier A5
- Schutzanzüge
- Monitore
- Farbpapier A4 recycling
- Bastelpapiere (Moosgummi usw.)
- Sonstige Badezimmermöbel
- Ball-Spiele
- Gesellschaftsspiele
- Flächen-Desinfektionsmittel
- Spielwelten
- Ferngesteuerte Autos
- Ferngesteuerte Hubschrauber
- Luftentfeuchter/ -befeuchter
- Kochplatte
- Kartonumreifung (Geräte u. Zubehör)
- Freisprecheinrichtungen
- Wearables
- Schulranzen
- Schlagwerkzeuge (Hammer, Beitell...)
- Wasserspielzeug
- Multifunktionsgeräte Tinte
- Kurzwaren
- Drucker Tinte
- Sonstige Spiele
- Spezialschlösser
- Dichtmasse, Klebepistolen
- Tablet-PCs
- Drucker Laser Mono
- Sonstiges Outdoor-Spielzeug
- Autorennbahnen
- Spielzeugautos
- Betriebssysteme
- Kantinentische
- Lernspielzeug
- Anwenderprogramme (Textverarbeitung...)
- Konstruktionsspielzeug
- Multifunktionsgeräte Laser Color
- Personal Computer
- Gedächtnisspiele
- Zubehör DVB-T
- Schneideplotter
- Thermodrucker, Thermotransferdrucker
- Trainingsgeräte
- Puzzle
- Bodenschutzmatten
- Drucker Laser Color
- Haartrockner
- Hängewaagen
- Kaffeevollautomaten
- Zubehör Camcorder
- Taschen
- Schubladenschränke Holz, Kunststoff
- Rollenspielzeug
- Büroklebefilm 76 mm Kern
- TV- u. HiFi-Möbel
- Utilities/ Virenschutz
- Sonstige Uhren
- Zubehör Microsoft-Konsolen
- Bankformulare
- Schnurlose Telefone mit Anrufbeantworter
- Multifunktionsgeräte Laser Mono
- Gießkannen
- Leuchtstofflampen u. -röhren
- Inkjetpapier A4 weiß 80g
- Fahrrad-Navigationssystem
- Notebooks
- Zubehör Tresore
- Spiel-/Sammelfiguren
- Zeitschaltuhren
- Drucker Matrix
- Kompakt-Anlagen
- Briefmarken
- Grafik-/Soundkarten, Videokarten/MPEG
- sonstige elektrische Kühlgeräte
- Malbücher
- Alarmanlagen
- Haftnotizen Großformate
- Receiver
- Massagegeräte
- Teppiche
- Weltempfänger
- MP3-Player
- Camcorder (alle Formate)
- Fernseher-LED über 50"
- Raumerfrischer
- Schneidelineale
- Zubehör Multifunktionsgeräte
- Fußmatten
- Fernseher-LED 30" bis 39"
- Fernseher-LED 40" bis 49"
- Übertöpfe
- Halterungen für Beamer
- Zubehör Lautsprecher/Kopfhörer
- Pools
- Atemschutz
- Zubehör Sony Playstation-Konsolen
- Kabeltrommeln
- Elektrische Haarentfernungsgeräte
- Haushaltsreinigungsmittel
- Puppen
- Gummiringe u. -bänder
- Lose
- Zubehör
- Geschirrspülmittel
- Sonstige Büroschränke Holz, Kunststoff
- Waschmittel
- Hebezeuge, Saugheber
- Universalpapier A3 recycling
- Sony Playstation-Konsolen
- Standgarderoben
- Autoradio-DVD
- Korrekturroller Einweg
- Nintendo-portable Konsolen
- Reisezubehör (Gepäckanhänger, Gurte...)
- Sägen
- Arbeitsoberteile (ohne Jacken & Kittel)
- Arbeitsjacken
- Kabel (z.B. Drucker-, Schnittstellenk.)
- Sonnenschutz
- Einschreiben
- Schleifwerkzeuge (Feile, Raspel, Hobel)
- KFZ-Ladekabel
- Klebestifte
- Fixier-, Abdeck- u. Kreppbänder
- Tischkalender
- Sonstige Schutzausstattung
- Korrekturroller Mehrweg
- Badvorleger
- Sonstige Elektrowärme- u. Klimageräte
- Fernseher-LED bis 26"
- Pflanzenroller
- Packbänder PP
- Malerwerkzeuge
- Sonstige Aschenbecher
- Backöfen
- Sonstige Geräte zur Datenspeicherung
- Herd-Set
- Seifen
- Kaufmännische Software
-
« Fahrräder
- « Fahrradteile
- « Bekleidung
-
« Fahrradzubehör
- « Fahrradbeleuchtung
- « Körbe & Fahrradtaschen
- Rucksäcke
- « Fahrradcomputer
- Autodach- und Fahrradträger
- « Fahrradschlösser
- « Fahrradpumpen
- « Trinkflaschen & -halter
- « Gepäckträger
- Klingeln & Hupen
- Kinderartikel
- Reparatur & Pflege
- Fahrradanhänger
- Kindersitze
- « Trinkflaschen & -halter, Fahrradzubehör
- Skate-Scooter
- « Klingeln & Hupen, Fahrradzubehör
- « Bekleidung, Bekleidung
- « Fahrräder
- « E-Bikes
-
« Hörbuch-Downloads
- « Fremdsprachige Hörbücher
- « Krimis & Thriller
- « Romane & Erzählungen
- « Kinderhörbücher
- Kinder- & Jugendhörbücher
- « Hörspiele
- « Sachbücher & Ratgeber
- « Sprachen & Lernen
-
« Beliebte Autoren
- Carter, Chris
- Suter, Martin
- King, Stephen
- Brecht, Bertolt
- Gruber, Andreas
- Hirschhausen, Eckart von
- Grisham, John
- Neuhaus, Nele
- Leon, Donna
- Gabaldon, Diana
- Funke, Cornelia
- Fitzek, Sebastian
- Poznanski, Ursula
- Sparks, Nicholas
- Ohlandt, Nina
- Follett, Ken
- Archer, Jeffrey
- Allende, Isabell
- Christie, Agatha
- Austen, Jane
- Kerkeling, Hape
- Link, Charlotte
- von Schirach, Ferdinand
- Barksdale, Ellen
- Wolf, Klaus-Peter
- Kepler, Lars
- Brown, Dan
- Falk, Rita
- Moers, Walter
- Kling, Marc-Uwe
- Lind, Hera
- Zeh, Juli
- Gablé, Rebecca
- Nesbo, Jo
- Boyle, TC
- Bannalec, Jean-Luc
- Beckett, Simon
- Safier, David
- Simsion, Graeme
- Moyes, Jojo
- Jonasson, Jonas
- « Comedy & Humor
- « Entspannung
- « Science Fiction & Fantasy
- « Beliebte Verlage
- « Biografien
-
« Beliebte Reihen für Erwachsene
-
« Krimi
- « Sherlock Holmes
- Oscar Wilde & Mycroft Holmes
- Bunburry - Ein Idyll zum Sterben
- Agatha Raisin
- Nathalie Ames ermittelt - Tee? Kaffee? Mord!
- Bruno,Chef de Police
- Paul Temple
- Jack Ryan
- Mimi Rutherfurt
- Cherringham
- Kloster, Mord und Dolce Vita
- Dorian Hunter
- Mord in Serie
- Sofia und die Hirschgrund-Morde
- Kommissar Pierre Durand
-
« Kinderbücher
- Die drei !!!
- Astrid Lindgren
- Die drei ??? Kids
- Conni
- Wieso? Weshalb? Warum?
- Der kleine Vampir
- Die Playmos
- Wir Kinder aus dem Möwenweg
- TKKG Junior
- Liliane Susewind
- Nordseedetektive
- Star Wars
- Der kleine Drache Kokosnuss
- Lieselotte
- Hanni und Nanni
- Tilda Apfelkern
- Bobo Siebenschläfer
- TKKG
- LEGO® Friends
- Fünf Freunde
- Mein Lotta-Leben
- Geschichten vom Franz
- Geolino extra
- Benjamin Blümchen
- Harry Potter
- LEGO® Ninjago
- Das Sams
- TKKG Retro-Archiv
- Bob der Baumeister
- Bibi & Tina
- Eliot und Isabella
- Janoschs Figurenwelt
- Schleich - Horse Club
- Bibi Blocksberg
- Die geheime Drachenschule
- Die Schule der magischen Tiere
- Der kleine Rabe Socke
- LEGO® City
- Die Olchis
- Leo und die Abenteuermaschine
- Die Eule mit der Beule
- Rico & Oskar
- Leo Lausemaus
- Lauras Stern
- Caillou
- Das kleine böse Buch
- Cry Babies
- Das wilde Pack
- Sternenschweif
- Abenteuer & Wissen
- Paw Patrol
- Legende der Wächter
- « Sciene Fiction
- « Thriller
- « Historisch
- « Sachbuch
- « Jugendbücher
- « Fantasy
- « Liebe
-
« Krimi
- « Jugendhörbücher
- Reise & Abenteuer
- « Bundles
- BookTok
- « Exklusive Hörbuch-Downloads
- Märchen & Sagen
-
« Hörbücher
- « Entspannung
- « Fremdsprachige Hörbücher
- « Romane & Erzählungen
-
« Kinder- & Jugendhörbücher
-
« Beliebte Reihen & Charaktere
- Der kleine Rabe Socke
- Conni
- Die drei ??? Kids
- TKKG
- Star Wars
- Der kleine Drache Kokosnuss
- Bobo Siebenschläfer
- Harry Potter
- Lotta-Leben
- Pettersson & Findus
- Schleich - Horse Club
- Die drei ???
- Die Teufelskicker
- Paw Patrol
- Die Olchis
- Die Schule der magischen Tiere
- Fünf Freunde
- Was ist Was?
- Astrid Lindgren
- LEGO® Ninjago
- Leo Lausemaus
- Benjamin Blümchen
- Die Playmos
- Wieso? Weshalb? Warum?
- « Nach Alter
- « Hörbuchboxen
- Fantasy
- Lern- & Sachgeschichten
- Abenteuergeschichten
- Tiergeschichten
- Geschichten & Lieder
-
« Beliebte Reihen & Charaktere
- « Hörspiele
- « Krimis & Thriller
- « Sachbücher & Ratgeber
- « Science Fiction & Fantasy
-
« Beliebte Autoren
- Lind, Hera
- Moyes, Jojo
- Heldt, Dora
- King, Stephen
- Riley, Lucinda
- Jonasson, Jonas
- Renk, Ulrike
- Suter, Martin
- Boyle, T.C.
- Bomann, Corina
- Falk, Rita
- Simsion, Graeme
- Link, Charlotte
- McFarlane, Mhairi
- Neuhaus, Nele
- Ebert, Sabine
- Cornwell, Bernard
- Lorentz, Iny
- Prange, Peter
- Austen, Jane
- Christie, Agatha
- Kling, Marc-Uwe
- Durst Benning, Petra
- Hirschhausen, Eckart von
- Kerkeling, Hape
- Zeh, Juli
- Colgan, Jenny
- Berg, Ellen
- von Schirach, Ferdinand
- Lunde, Maja
- Moers, Walter
- Allende, Isabel
- Leon, Donna
- Funke, Cornelia
- Wolf, Klaus-Peter
- Hansen, Dörte
- Archer, Jeffrey
- Nesbo, Jo
- Stanišić, Saša
- Maurer, Jörg
- Poznanski, Ursula
- Gabaldon, Diana
- Follett, Ken
- « Comedy & Humor
- « Biografien & Erinnerungen
- Märchen
- Gesunde Ernährung
- « Sprachkurse & Lernhilfen
- Hörbuch-MCs
- Reise & Abenteuer
- Hörbuch-LPs
- « Beliebte Reihen für Erwachsene
-
« JeansWelt
- Damenmode/Marken
- Herrenmode
- Oberteile/Shirts & Tops
- Herrenmode/Jeans/Regular Fit Jeans/Cross
- Damenmode
- Herrenmode/Jeans in Überlänge
- Marken
- Herrenmode/Jeans/Regular Fit Jeans
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans/Schwarz
- Herrenmode/Jeans/Stretchjeans/Stretchjeans Regular Fit
- Herrenmode/Sale/Jeans
- Herrenmode/Jeans/Stretchjeans/Dunkelblau
- Herrenmode/Jeans/Slim Fit Jeans/Slim Fit Stretch Jeans
- Damenmode/Jeans /High Waist Jeans
- Beratung Online/Jeans
- Herrenmode/Sale
- Herrenmode/Marken/Pioneer
- Sale/Unterwäsche
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans/Timezone
- Marken/ragwear
- Oberteile/Langarm-Shirts
- Hosen
- Herrenmode/Jeans/Stretchjeans
- Herrenmode/Jeans
- Mode 2024
- Oberteile/Blusen & Tuniken
- Marken/Tom Tailor
- Damenmode/Kleider & Röcke/Kleider Kurzarm
- Oberteile/Pullover
- Jacken
- Marken/Soquesto
- Herrenmode/Marken/Paddock's
- Herrenmode/Marken/Timezone
- Damenmode/Neu
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans/Blau
- Herrenmode/Jeans/Stretchjeans/Pioneer
- Damenmode/Jeans /Straight Leg Jeans
- Herrenmode/Marken
- Herrenmode/Marken/Mustang
- Modemarken
- Herrenmode/Hosen
- Neuheiten
- Herrenmode/Jeans/Stretchjeans/Stretchjeans Slim Fit
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans/Stretch Jeans Größe 44
- Herrenmode/Jeans/Stretchjeans/Stretchjeans Sale
- Herrenmode/Jeans/Straight Leg/Wrangler
- Herrenmode/Marken/questo
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans/Cross
- Herrenmode/Jeans/Tapered Jeans/Wrangler
- Damenmode/Jeans /Regular Fit Jeans/Blau
- Damenmode/Jeans /Slim Fit Jeans/Blau
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans/Stretch Jeans Größe 48
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans/Paddock's
- Damenmode/Jeans /Regular Fit Jeans
- Damenmode/Jacken
- Marken/FreeQuent
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans/Hellblau
- Marken/Cross Jeanswear
- Damenmode/Accessoires/Gürtel
- Herrenmode/Marken/Wrangler/Wrangler Texas
- Herrenmode/Marken/Blue Monkey
- Herrenmode/Jeans/Tapered Jeans/Schwarz
- Herrenmode/Jeans/Tapered Jeans/Cross
- Kleider & Röcke/Midikleider
- Damenmode/Marken/einfach Schön
- Damenmode/Marken/Cross
- Damenmode/Jeans /Regular Fit Jeans/Regular Fit Jeans Größe 46
- Damenmode/Sale/Blusen
- Damenmode/Hosen
- Herrenmode/Jeans/bequeme Jeans
- Damenmode/Jeans
- Herrenmode/Jeans/Stretchjeans/Cross
- Hosen/7/8 Hosen
- Modemarken/Pioneer Mode
- Herrenmode/Marken/Cross Jeanswear
- Damenmode/Jeans /Slim Fit Jeans/Slim Fit Skinny Jeans
- Damenmode/Jeans /Stretchjeans/Grau
- Herrenmode/Jeans/Straight Leg/Revils
- « Kontaktlinsen & Brillen
- « Kraftsport
- « Küchenhelfer
- Notfallradios
-
« Spielwaren
- « Nach Alter
- « Gesellschaftsspiele
-
« Beliebte Marken
- « Ravensburger
- Schmidt Spiele
- « Siku
- Theo Klein
- « Brio
- « Kosmos
- « Pegasus
- Goki
- HAMA
- « Corvus
- Moses
- « Asmodee
- HABA
- « LEGO
- « Tiptoi
- « small foot
- « Schleich
- « Barbie
- « DENKRIESEN
- « Hasbro
- Vtech
- « Tonies
- « tiger®
- Spin Master
- « GraviTrax
- Carrera
- Disney
-
« Playmobil
- PLAYMOBIL® 3-5 Jahre
- PLAYMOBIL® 8-10 Jahre
- PLAYMOBIL® 6-8 Jahre
- PLAYMOBIL® 5-6 Jahre
- PLAYMOBIL® Special Plus
- PLAYMOBIL® City Action
- PLAYMOBIL® My Life
- PLAYMOBIL® Country
- PLAYMOBIL® Novelmore
- PLAYMOBIL® 1-3 Jahre
- PLAYMOBIL® Junior
- PLAYMOBIL® Adventures of Ayuma
- PLAYMOBIL® Figures
- PLAYMOBIL® Stuntshow
- PLAYMOBIL® Summer Fun
- PLAYMOBIL® Horses of Waterfall
- « Zapf Creation
- Schipper
- Steiff
- Bullyland
- iDventure
- ZURU
- Mattel
- MGA Entertainment
- Funko
- Panini
- « Kartenspiele
- « Puzzle & Legespiele
- « Lernspiele
- « Technik & Experimente
- « Rollenspiele & Feste feiern
- « Die Welt der Fahrzeuge
- « Kreativ & Basteln
- « Puppen
- « Spielwelten & Figuren
- « Draußen spielen
-
« Babywelt
- « Beliebte Marken
- « Kinderzimmer
- « Unterwegs
- « Pflegen
- Bade- & Draußenspielzeug
- « Badezimmer
- Kuscheltiere & Puppen
- « Ernähren
- Bauen & Konstruieren
- Rasseln & Greiflinge
- Holzspielzeug
- « Kleidung
- Schnuller & Schnullerketten
- Puzzle
- Mobiles & Spieluhren
- Sicherheit
- Bobbycars & Laufräder
- Spielzeugautos & Flugzeuge
- « Bauen & Konstruieren
- « Beliebte Kinderfiguren
- « Modelleisenbahn
- « Modellbau
- « Kuscheltiere
- Holzspielzeug
- Musikinstrumente
- « Tiernahrung
-
« Uhren & Schmuck
-
« Schmuck
- « Allaxo
- « Boccia
- « Joop
- « Morellato
- « s.Oliver
- « Tommy Hilfiger
- « Viventy
- « Merii
- « trendor
- « Pandora
- « Xen
- « Engelsrufer
- « Josh
- « Paul Hewitt
- « Thomas Sabo
- « Astra
- « Sif Jakobs Jewellery
- « IUN Silver Couture
- « Xenox
- « Lott Gioielli
- « Julie Julsen
- « DKNY
- « Coeur de Lion
- « P D Paola
- « Save Brave
- « Herzengel
- « Maserati
- « Ti Sento
- « Acalee
- « Elaine Firenze
- « BOSS
- « Disney
- « Michael Kors
- « Leonardo
- « Guess
- « Police
- « Philipp Plein
- « Blush
- « Liebeskind Berlin
- « Hot Diamonds
- « Purelei
- « Estella Bartlett
- « Lotus
- « Seinerzeit
- « Rebel and Rose
- « Lacoste
- « Fossil
- « Victoria Cruz
- « Calvin Klein
- « caï
- « Jacques Lemans
- « GLIZZ
- « Jette
-
« Uhren
- « Casio
- « Citizen
- « Jacques Lemans
- « Junghans
- « Nixon
- « Regent
- « s.Oliver
- « Seiko
- « trendor
- « Komono
- « Estura
- « Master Time
- « KHS
- « Julie Julsen
- « Bulova
- « Mido
- « Kerbholz
- « ETT
- « Sternglas
- « Maserati
- « Tissot
- « Coeur de Lion
- « Lorus
- « Vostok Europe
- « Police
- « Zeppelin
- « Hamilton
- « Certina
- « Luminox
- « Ice-Watch
- « Philipp Plein
- « Iron Annie
- « Poljot International
- « Boccia
- « Messerschmitt
- « traser H3
- « Bauhaus
- « Guess
- « Versus by Versace
- « Sturmanskie
- « Festina
- « Mondaine
- « Ruhla
- « Lotus
- « Withings
- « Sector
- « Jacob Jensen
- « Lacoste
- « Michael Kors
- « Fossil
- « Tommy Hilfiger
- « Calvin Klein
- « Glock
- « Accessoires
- « Großuhren
-
« Schmuck
-
« Verpackungen
-
« Verpackungsmaterial
- « Stretchfolien
- « Kartons
- « Klebebänder
- « Versandtaschen
- « Folien
-
« Beutel
- Papier-Faltenbeutel
- Abreißbeutel geblockt
- Druckverschlussbeutel
- « Adhäsionsverschlussbeutel
- Flachbeutel
- Kordelzugbeutel
- Schiebeverschlussbeutel
- Schnellbinder
- Schweißgeräte
- Verschlussmaschinen
- « Standbodenbeutel
- « Schnellverschlussbeutel
- Flachbeutel Vlies
- Vakuumbeutel
- « Blockbodenbeutel
- Kreuzbodenbeutel mit Siegelnaht
- Beutelverschlüsse
- Seitenfaltenbeutel m. Siegelnaht
- Flachbeutel mit Siegelnaht
- Seitenfaltenbeutel
- Bodenbeutel PP
- Quad Bags
- Flachbeutel HDPE
- Papier-Flachbeutel
- Kreuzbodenbeutel Papier
- « Dokumententaschen
- « Säcke
- « Packpapier
- « Luftpolsterfolie
- Wellpappe
- « Umreifungsbänder
- « Verpackungschips
- « Kantenschutz
- « Luftpolstertaschen
- Schaumfolie
- Luftpolsterkissen
- Schützen und Polstern
- « ColomPac
- Schneiden und Cutten
-
« Gastrobedarf
- « Beutel und Säcke
- « Bäckerei-Konditorei
- « Gastroverpackungen
- « Gedeckter Tisch
-
« Einweggeschirr
- « Feinkostbecher
- « Trinkbecher
- « Heißgetränkebecher
- Pappteller
- Gläser
- Pappschalen
- Pappbecher
- « Deckel
- Besteck
- Cateringplatten
- « Smoothies
- « Grillschalen
- « Alu-Geschirr
- « Thermoschalen
- Mikrowellengeschirr
- Schaschlikspieße und Holzstäbe
- Fingerfood
- « BIO-Einweggeschirr
- « Suppenteller
- Eisbecher
- Gourmet Box
- Thermobecher
- « Trinkhalme
- Kunststoffschalen
- Manschetten für Becher
- Eierverpackungen
- « Mehrwegverpackungen
- Thermo-Bonrollen
- Siegelgerät und Zubehör
- Speisekarten
- Kreidetafeln
- Tischkartenhalter
- Hinweisschilder
- Leitsystem
- Kinder-Gastro-Zubehör
- « Haushalt
- « Betriebsausstattung
-
« Büroartikel
- « Organisation
- Etiketten
- Scheren und Cutter
- « Klebebänder
- « Laminieren und Zubehör
- « Binden und Zubehör
- « Heften und Lochen
- Geldkassetten
- « Archivieren
- Klebemittel
- Spitzmaschinen
- Schreibtischsets
- Briefumschläge
- Aktenvernichter
- « Archivsysteme
- Büropapier
- « Umzugsbedarf
- « Hygiene
-
« Verpackungsmaterial